Was ist Kulturvermittlung? Wer macht sie und für wen? Forum Kultur Vermittlung und ICOM CECA Austria laden Vermittler*innen, Kurator*innen und Kunst- & Kulturmacher*innen zu fünf guten Fragen in unsere „Sicht Bar“ ein:
- Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
- Was ist 2020 / 2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
- Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
- Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
- Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Die Antworten werden in regelmäßigen Abständen auf den Kommunikationskanälen von FKV und ICOM CECA publiziert.
Wir freuen uns über Interessierte, die ihre Sichtweise teilen möchten: contact(at)forumkulturvermittlung.at
Hinweise zur Einsendung: bitte kurze und prägnante Antworten, gerne mit ein paar Zeilen zur Person sowie einer Abbildung (Foto/Abbildung, die für die/den Autor*in für Kulturvermittlung steht oder ein Portraitfoto, inkl. Credits).
Eine Kooperation von Forum Kultur Vermittlung und ICOM CECA Austria.

Mit Eva Meran
Welche drei Wörter beschreiben für Dich Kulturvermittlung heute?
(ver)suchen, (ver)lernen, (ver)handeln
Was ist 2020/21 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Im hdgö haben wir den direkten Austausch mit den Besucher*innen sehr vermisst. Zugleich hat der zwischendurch ruhigere Betrieb die Arbeit an neuen Projekten ermöglicht, die wir auch für die Zukunft mitnehmen.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du gestolpert bist?Kulturvermittlung in Museen wäre nur dazu da, um Geld einzuspielen.
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Kulturvermittlung kann Räume öffnen – zum Diskutieren, um voneinander zu lernen und kritische Fragen zu stellen. Zum Beispiel: Wer ist hier wir?
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Es ist ein höchst anspruchsvolles Arbeitsfeld – Bezahlung, Anstellungsverhältnisse und Perspektiven für Vermittler*innen stehen vielerorts in keinem Verhältnis dazu.
Eva Meran verantwortet den Bereich „Diskussionsforum und Kulturvermittlung“ im Haus der Geschichte Österreich. www.hdgoe.at

Mit Petra Fuchs-Jebinger
Welche drei Wörter beschreiben für Dich Kulturvermittlung heute?
Ständiges Hinterfragen, Diversität, Partizipation
Was ist 2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Die Covid-Krise hat die prekäre Situation der Kunst- und Kulturvermittler sichtbar gemacht und ich hoffe, dass dieser Fokus eine nachhaltige Veränderung – das heißt reguläre Anstellungen – mit sich bringt. Im Moment sieht es ganz danach aus als gäbe es hier Bewegung, insofern hätte die Pandemie sogar etwas Gutes gehabt.
Digitale Vermittlung war ein sehr großes Thema im letzten Jahr. Ich war überrascht von dem Hype um Vermittlungsvideos. Das Format überzeugt Kulturvermittler*innen nicht und dennoch haben viele von uns damit experimentiert. Digitale Schulworkshops hätte ich vor der Pandemie keinesfalls in Erwägung gezogen, inzwischen sehe ich darin auch Potential Angebote für Schulen zu schaffen, die nicht nach Wien kommen können. Aber gute Vermittlungsarbeit sieht immer noch anders aus. Ich will diese Pandemie aber auch als Chance für die Kulturvermittlung sehen. Wir probieren vieles aus, hinterfragen unsere Arbeit noch mehr als davor und das ist gut so. Ich arbeite in einem Bundesmuseum und der Fokus des Haupthauses lag auf dem Tourismus, der natürlich vollkommen weggebrochen ist. Es wurde deutlich, dass das lokale Publikum mehr angesprochen werden muss, und ich hatte den Eindruck, dass erst da viele Abteilungen des Hauses auch das Potential der Vermittlungsarbeit erkannt haben. Die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit hat sich dadurch verbessert.
Ich versuche positiv in die Zukunft zu blicken, wir stehen aber sicher an einem sehr kritischen Punkt, denn viele der schlecht angestellten Kulturvermittler*innen Österreichs haben im letzten Jahr ihre Perspektive in diesem Berufsfeld verloren.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du gestolpert bist?
Vermittlung ist ein Sales Produkt und muss gewinnorientiert arbeiten oder sich zumindest selbst tragen.
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Weil wir eine diverse Gesellschaft sind, mit diversen Bedürfnissen. Kulturvermittlung schafft Brücken zwischen den immer noch elitären Kultureinrichtungen und den Menschen „da draußen“.
Was möchtest Du gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Wir brauchen faire Anstellungen. Ist das mal geschafft, wird man auf diese Jahrzehnte der Werkverträge, freien Dienstverträge und absurden Scheinanstellungen zurückblicken und sich fragen: Wie konnte es nur sein, dass Vermittlung – als so wesentlicher Teil einer Kultureinrichtung – so außen vor gelassen wurde? Völliges Unverständnis wird herrschen – ich freue mich darauf!
Petra Fuchs-Jebinger studierte Kunstgeschichte und Kultur- & Sozialanthropologie in Wien und Lausanne. Während ihrer Studienzeit arbeitete sie als Kunst- und Kulturvermittlerin, aufgrund der Perspektivenlosigkeit der branchenüblichen freien Dienstverträge wechselte sie in die Privatwirtschaft und entwickelte mit und für Museen digitale Vermittlungsstrategien. Seit 2019 leitet Petra Fuchs-Jebinger die Abteilung Kulturvermittlung im Weltmuseum Wien.

Mit Barbara Stieff
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
> Beziehung herstellen – zwischen den Besucher*innen und dem Objekt, dem Wissen, der Institution.
> Individualisierung – Jede*r Besucher*in ist ein eigenes Universum mit speziellen Interessen, Bedürfnissen, Voraussetzungen. Je flexibler und offener die Vermittlung, desto treffsicherer kann sie werden.
> Hybridisierung – Vermittlungskanäle öffnen und mischen zwischen analoger Vermittlung von Mensch zu Mensch und digitalen Angeboten.
Was ist 2020 / 2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Die digitalen Angebote sind reichhaltiger und fantasievoller geworden und die Nutzer*innen wissen darum und können aktiv danach suchen.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Den meisten ist Kulturvermittlung nach wie vor unbekannt. Wenn aber doch, werden Vermittler*innen als „institutionelle Lehrer*innen“ angesehen, die das Klischee des Lernens im Frontalunterricht perpetuieren: „Du redest, ich höre (nicht) zu.“
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Solange es das längst veraltete Schulsystem noch gibt, braucht es unbedingt alternative Angebote, die eine ergänzende Form der Wissens- und Erfahrungsschöpfung anbieten. Kultur- , Natur-, Kunst- und Wissensvermittlung können einen wichtigen Beitrag dazu leisten.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Als selbständige Kultur- und Wissensvermittlerin ist es mir ein Anliegen, Schnittstellen zwischen der analogen und digitalen Vermittlung auszuloten, mögliche Fronten aufzuheben und sinnvolle Hybride zu schaffen. Besonders in der Kunstvermittlung finde ich es wichtig, Bezüge zwischen der Kunst und dem Leben und den Erfahrungswelten der Besucher*innen zu schaffen, frei nach dem Motto: „Und was hat das alles mit mir zu tun?“
Barbara Stieff hat Grafik Design, Schauspiel, Kreativitätstraining und Kulturmanagement gelernt / studiert. Sie ist seit 20 Jahren als Konzepterin, Produzentin und Vermittlerin selbständig. Ihre Firma TEXTOUR erstellt Audioguides, Hörstationen, Hörspiele, Bücher, Texte, sie kuratiert Kinderbereiche und beschäftigt sich seit 2020 gemeinsam mit Partnerfirmen mit multimedialen, hybriden (digital/analog) und gamifizierten Vermittlungsformaten. www.textour.at

Mit Roman Schanner
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
„Kultur MIT allen“
(immer noch, wie erstmals vor gefühlten 25 Jahren gemeinsam mit Walter Stach und dem Büro für Kulturvermittlung erstmals formuliert ;-))
Was ist 2020 / 2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Digitalität wird als Heilmittel für fast alles angeführt, so intensiv, dass es mehr denn je gilt, den Wert des analogen, haptischen, sinnlichen, der persönlichen Begegnung hoch zu halten.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
„Können sie mir eine Opernsängerin vermitteln?“ (Kulturvermittlung quasi als Künstler*innen-Agentur-Tätigkeit)
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Für Teilhabe und Zugang möglichst aller, an Kulturinstitutionen, wie am kulturellen Leben allgemein… Ja überhaupt: Kultur nicht als Elitethema (im Sinne der Hochkulturellen Produktionen und Präsentationen) zu verstehen, sondern als Ausdruck jedes persönlichen Lebens.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Von und hin zu den Kulturinstitutionen gedacht (auch und – hier leider – immer noch) den Wert der Arbeit der Kulturvermittler*innen – als das professionelle, verbindende Element zwischen Institutionen und Bevölkerung (und damit sind sowohl personale als auch mediale Vermittlung gemeint – wobei noch zu ergänzen wäre, dass Kulturvermittlung heute wohl nur im Miteinander von Personalem und Medialem gedacht, sichtbar gemacht und auch gelebt werden kann – was so schön neudeutsch „hybrid“ genannt wird, also „hybride Kulturvermittlung?! 😉
Roman Schanner (*1965), abgeschlossenes Studium „Publizistik und Kommunikationswissenschaften“, sowie „Politologie“ (Mag. Phil.). 1998 – 2002 inhaltliche und organisatorische Leitung des österreichischen „Lehrlingskulturfestivals“, Leitung der Projektreihen zur Kulturvermittlung mit Lehrlingen („Büro für Kulturvermittlung“ bis Ende 2003). Von 2004 bis 2019 bei „KulturKontakt Austria“ und seit 2020 beim „OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung“ im Bereich Kulturvermittlung für die Koordination der österreichweiten Projektreihen mit Lehrlingen zuständig. Entwicklung von Projektmodulen zur Kulturvermittlung von Kultureinrichtungen mit neuen Besucher*innengruppen (etwa Lehrlingen, Senior/innen oder Migrant/innen), Projektentwicklungen zur Geschichtsvermittlung mittels kultureller Bildung, sowie Projektleitung in EU-Förderprogrammen. Als Selbständiger Kulturvermittler seit 2010 Partner von „Hunger auf Kunst und Kultur“ im Rahmen der Initiative „Kultur-Transfair“.

Mit Helga A. Gruber
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
> Wirken: Kulturvermittlung erweitert den Raum für individuelle und gesellschaftliche Wirkung von Kunst und Kultur – wechselseitig, denn sie wirkt auf Kunst und Kultur zurück.
> Bestäuben: zwischen Kunstwerk/Ausstellung/ Kulturschaffenden und im weitesten Sinn Rezipient*innen, dazu zählen auch interne Mitarbeitende und Kolleg*innen;
Bestäubung erfolgt auf mannigfaltige Weise – durch Wissensvermittlung, kreatives-künstlerisches Tun, Begleitprojekte, Gedankenaustausch u.v.m. Das, was daraus entsteht, ist nicht vorherbestimmbar.
> Begegnen: Kulturvermittlung fördert Begegnung mit und unter Rezipient*innen und auch Kulturschaffenden dank gemeinsamem Erleben und Austausch
Was ist 2020 / 2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Erfindungsschub in der digitalen Vermittlung, gleichzeitig neuer Fokus auf analoge Formen, die durch digitale nicht ersetzbar sind.
Andererseits Abbruch von zahlreichen Projekten und Arbeiten, existentielle Krisen von Kulturschaffenden und -institutionen, starke Veränderungen im gesellschaftlichen Umfeld.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Vermittlung ist Verkauf
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Je nach der Person, welche diese Frage stellt, gibt es unterschiedliche Antworten. Aus allgemein gesellschaftlicher Perspektive kompensiert die Kulturvermittlung vorgefasste Haltungen gegenüber bestimmten Formen von Kunst und Kultur, deren geringen Stellenwert, traditionelle politische Instrumentalisierungen, usw.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Kulturvermittlung ist eine Hin- und Her-Bewegung: vom Kunstwerk/Kulturschaffenden zum Publikum und umgekehrt.
Kulturvermittlung kann Begegnungen auf Augenhöhe ermöglichen, die Impulse des Publikums auch für Künstler*innen und Kurator*innen wirksam werden lassen, sogar zu neuen Kunstwerken, Ausstellungen u.a. anregen – bislang eine wenig wahrgenommene und wenig genutzte Chance einer selbstbewussten Kulturvermittlung.
Helga Anna Gruber ist freiberufliche Projektentwicklerin und Beraterin, geschäftsführende Obfrau des Vereins Kule http://www.kulekultur.at zur Entwicklung von neuen Tätigkeitsfeldern zwischen Kultur, Bildung und Sozialem.
Bis 2015 war sie leitende Mitarbeiterin am Toihaus Theater in Salzburg: Sie entwickelte zahlreiche Kooperationsprojekte mit Kultur- und Bildungs-Institutionen im In- und Ausland, auch mit Förderung durch EU-Programme. Sie gründete und leitete 8 Jahre lang das internationale Theaterfestival BIM BAM für Klein(st)kinder, begleitend arbeitete sie im Management-Team des europäischen Großprojekts SMALL SIZE. Daneben entwickelte sie internationale und EU-geförderte Projekte für die Stadt Bad Ischl und das Lehár Festival (2006 – 2012). Seit 2016 ist sie für die Bereiche kulturelle Bildung und Kulturvermittlung in den Salzburger Landeskulturbeirat berufen.
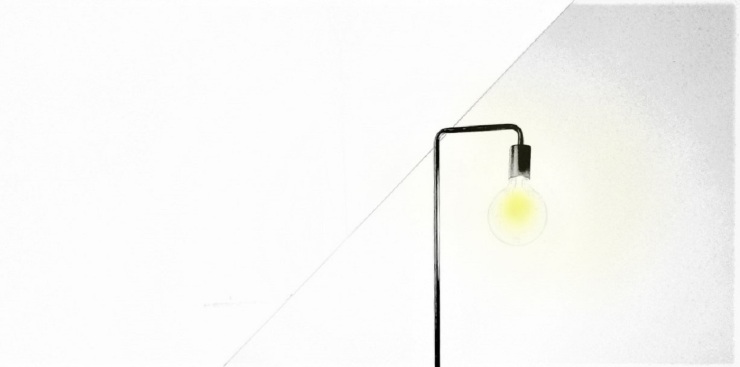
Mit Jonathan Achtsnit
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
Ästhetische & Kulturelle Bildung, in-der Mitte stehen, verhandeln
Was ist 2020/2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
In der Kulturvermittlung stehen wir immer in der Mitte zwischen der Kunst und den Menschen. Aufgrund von Schließungen der Kultureinrichtungen, Veranstaltungsverboten, etc. ist dieses dazwischen-stehen ganz schön zur Zerreißprobe geworden. Das ist aber auch ein produktiver Prozess, weil wir in der Kulturvermittlung dadurch neue, digitale Wege gehen müssen. Eines der zentralen Momente von Vermittlung ist die Möglichkeit des Versammelns und des Verhandelns von Werten, Hierarchien, etc.. Wir müssen neue, oft digitale Möglichkeiten von Versammlung zu Verhandlung finden oder einen Fokus auf kleinere Vermittlungssettings legen. Das verschiebt auch den Blick von Quantität auf Qualität.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Ich werde ehrlich gesagt selten mit Klischees konfrontiert, weil sich viele Menschen unter dem Begriff “Vermittlung“ wenig vorstellen können. Gerade Kinder und Jugendliche wollen oft vielmehr wissen, was ich jetzt von ihnen will, als dass es sie kümmert, wie das heißt, was ich tue. Aber ein Vorurteil, das ich kenne ist: „Ihr macht immer diese vielen, lustigen Spiele“ oder „Ihr seid ein wirklich tolles Freizeitangebot“.
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Auf diese Frage hin, eröffnen sich mir gleich die nächsten Fragen: Wer ist dieses wir? Die Gesellschaft? Die Zielgruppen? Die Kunst? Die Vermittler*innen? Aus jeder Perspektive würde ich die Frage anders beantworten.
Da ich an einem Theater für junges Publikum arbeite, kann ich meine Arbeit durch das Kinderrecht auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben als Legitimität heranziehen. Gerade Kultureinrichtungen sind sehr hochschwellig und exkludierend, die Kulturvermittlung arbeitet oft intensiv daran, das zu ändern. Wenn ich diesen Gedanken ganz zu Ende denke, könnte es sogar sein, dass wir an unserer eigenen Abschaffung arbeiten. Wenn die Niedrigschwelligkeit von Kunst und Kultur gewährleistet wäre, bräuchte es uns nicht mehr. Bis dahin arbeiten wir weiter.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Ich möchte vor allem im Bereich der Theatervermittlung auf die desaströse Ausbildungslage in Österreich hinweisen. Es braucht dringend eine universitäre Ausbildung, die den Diskurs unterstützt und damit die Tätigkeit professionalisiert. Dann müssten wir über eine gemeinsame kulturpolitische Interessensvertretung der verschiedenen Vermittlungssparten, nachdenken: Gibt es gemeinsame Ziele und Visionen?
Als Nächstes müssten Förderschienen sowohl auf Bundes- als auch auf Ländereben etabliert werden. Es ist peinlich, dass es hier in Österreich keine beständige Förderschiene für Vermittlungsarbeit gibt.
Außerdem brauchen wir Kampfbegriffe, die wir gegenüber der (Kultur)Politik aufladen müssen. Wenn man nach Deutschland blickt, ist kulturelle Bildung in der Kulturpolitik schon seit Jahrzehnten ein sehr wirkmächtiger Begriff, der das Feld der Kulturvermittlung einen großen Aufschwung gebracht hat. In Österreich ist im öffentlichen Diskurs oft nur von Hochkultur die Rede. Da liegt noch sehr viel Arbeit vor uns.
Jonathan Achtsnit schloss 2015 den Masterstudiengangs für Theaterpädagogik an der Universität der Künste ab und arbeitete drei Jahre freiberuflich als Regisseur und Theaterpädagoge in Berlin u.A. für das Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit Deutschland, das GRIPS Theater, die Jugendtheaterwerkstatt Spandau, etc. Seit 2018 leitet Jonathan Achtsnit die Kunstvermittlung im DSCHUNGEL WIEN und interessiert sich für Community Buildung und kulturelle Bildung in der Kulturvermittlung.

Mit Peter Lichtenberger
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
> Perspektivenwechsel
> Tuchfühlung
> Wissen
Was ist 2020/2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Dass es Bestrebungen gibt Kulturvermittlung durch Handy-Apps zu ersetzen…
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Zwei davon:
> Sie müssen eh nur Texte heruntersagen, die andere geschrieben haben.
> Sie sind Akademiker und hier beim Land angestellt. Da verdienen sie eh sicher 4500 Euro netto im Monat.
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
> Um die Kulturinteressierten mit einem positiven Aha-Erlebnis das Museum oder die Kultureinrichtung zurück in die Welt zu entlassen.
> Insbesondere zu vermitteln, dass in einem Museum nicht einfach nur tote Materie steht oder hängt, sondern damit Geschichten in einem Kontext verbunden sind.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
> KV ist eine Berufung, nicht nur ein Beruf und schon gar keine Nebentätigkeit.
> Die finanziell prekäre Lage der KV.
> Manche Anfeindung in der Gesellschaft mit der Meinung „Das kann eh ein jeder der sich mehr als drei Worte merken kann“.
Peter Lichtenberger ist selbständiger Autor, Kultur- und Informationsvermittler (mit Schwerpunkt römische Antike und modernes Latein). Er absolvierte eine kaufmännische Ausbildung, studierte danach Informatik in Linz und war zwischenzeitlich als Projektleiter tätig ehe er zur KV kam. www.peter-lichtenberger.at
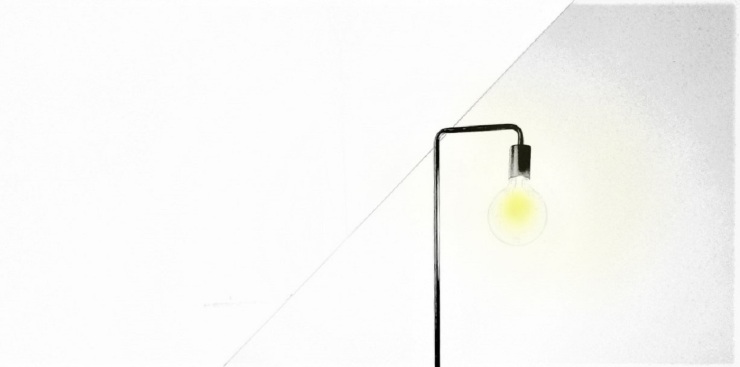
Mit Marion Grossmann
Welche drei Wörter beschreiben für Dich Kulturvermittlung heute?
Kulturvermittlung ist immer aktuell, auch wenn z.B. historische Themen vermittelt werden. Als Wort dazu wird vermutlich Gegenwartsbezug passen. Auch eine ständige Neuerung definiert Kulturvermittlung wohl sehr gut, damit meine ich ein permanentes Anpassen an vorwiegend gesellschaftspolitische Entwicklungen. Dieser Wandel schafft auch laufend Perspektiven bzw. Perspektivenänderungen.
Was ist 2020/21 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Kulturvermittlung wird von den Besucher*innen anders wahrgenommen, bewusster konsumiert. Die Möglichkeiten, sich auch während der Lockdowns der vergangenen Monate mit Kunst/Kultur und ihrer Vermittlung zu versorgen, haben sich als vielfältig und innovativ herausgestellt – aus der Not heraus haben sich zum Teil sehr spannende Vermittlungsformen gebildet. Es wird interessant sein zu beobachten, was davon bleibt und was nur temporär ist.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du gestolpert bist?
In meinem Tätigkeitsbereich – das Leben an der Donau vor 1.700 Jahren in einer römischen Provinzstadt, kommen häufig Fragen zu „den Rittern“.
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Ein Besuch in einer Kultureinrichtung ist (außer bei Schüler*innen im Klassenverband) immer eine Ausnahme – also eigentlich ein Urlaub vom Alltag. Erwachsene besuchen Kunst- und Kultur, um der Seele Futter zu geben. Kulturvermittlung dient eben dazu, die Seele mit neuen Eindrücken, neuen Perspektiven und vertiefendem Beschäftigen mit bestimmten Themen wieder positiv aufzupolstern.
Was möchtest Du gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Eine Aufwertung des Berufsbildes, die gesellschaftliche Akzeptanz der Tätigkeit sind meiner Meinung nach dringend notwendig.
Marion Großmann studierte in Wien, Athen und Rom Klassische Archäologie und nahm an zahlreichen Ausgrabungen im In- und Ausland teil. Seit 2008 selbst im Berufsfeld der Wissenschafts- und Kulturvermittlung tätig, absolvierte sie mehrere Aufbau-Lehrgänge und leitet seit 2013 die Kulturvermittlung in der Römerstadt Carnuntum.

Mit Christine Humpl-Mazegger
Welche drei Wörter beschreiben für Dich Kulturvermittlung heute?
> Neugierde
> Achtsamkeit
> Wissen
Was ist 2021 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Digitale Programme sind plötzlich wie Schwammerl aus dem Boden geschossen. Besucher*innen nutzen diese nun sehr häufig als Information vor oder zur Vertiefung nach einem Museumsbesuch bzw. wenn sie keine Möglichkeit haben, eine Ausstellung zu besuchen. Auffallend ist aber vor allem eine spürbare, oftmals auch direkt artikulierte Dankbarkeit der Gäste, die ein Museum nun wieder real besuchen können. Die Teilnahme an Programmen anderer Häuser sowie an Weiterbildungsveranstaltungen ist für Kunstvermittler*innen aufgrund zahlreicher digitaler Angebote nun niederschwelliger, häufiger und weltweit möglich, das genieße ich sehr.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du gestolpert bist?
Es ist verständlich, dass viele Besucher*innen neugierig über den Vermittlungsberuf sind und daher auch diesbezüglich Fragen stellen, wie beispielsweise „Haben Sie das Bild selbst ausgewählt?“. Was mir gar nicht gefällt ist die Verwendung von Berufsbezeichnungen, meist nur maskulin verwendet, die einfach falsch bzw. nicht mehr zeitgemäß sind, z.B. Tour-Guide, Museumswärter, Museumsführer.
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
In der Kunstvermittlung geht es meiner Meinung nach immer um die Menschen und um die Kunst / Objekte und es gilt, zwischen diesen zu vermitteln. Kunstvermittlung ermöglicht Momente der Begegnung, des Austauschs, des gemeinsamen Erlebens, Sehens, Fühlens – gesprochene Worte, gut aufbereitete Texte, Medien und vor allem auch die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden, gehören genauso dazu, wie auch Momente der Stille.
Was möchtest Du gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Kulturvermittler*innen verfügen über sehr diverse Berufsausbildungen, Arbeitserfahrungen und Talente, sie sind fast „Allrounder“ und stehen in ständigem Austausch mit Besucher*innen. Kulturvermittler*innen könnten dieses Potential sehr gut auch in andere Abteilungen einer Kulturinstitution einbringen, man müsste ihnen nur die Möglichkeit, ein offenes Ohr und entsprechende Rahmenbedingungen bieten.
Christine Humpl-Mazegger hat nach einem Studium der Kunstgeschichte und Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck, New Orleans und Chicago von 2000 bis 2009 als Kuratorin im Essl Museum, Klosterneuburg, gearbeitet. Seit 2010 ist sie freischaffend kuratorisch und publizistisch tätig, seit 2019 zudem als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Leiterin der Kunstvermittlung im Arnulf Rainer Museum, Baden.

Mit Katja Brandes
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
> Bildungsprozesse
> Offenheit
> Perspektivenwechsel
Was ist 2020 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Bei den wenigen möglichen Programmen ist eine besondere Wertschätzung des Publikums von Kunstbetrachtung vor Originalen spürbar, Gespräche gehen in die Tiefe.
(Um-)Organisation und Administration rauben viel Zeit. Mit Verlagerung der Tätigkeiten weg von Besucher*innenkontakten offenbaren sich aber auch ganz neue Talente im Team.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Was ist Ihr eigentlicher Beruf – also während der Woche?
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Kunstvermittlung hat das Potential, kulturelle Teilhabe für ein breites Publikum zu realisieren und das Museum als einen „Dritten Ort“ (neben Zuhause und Arbeitsplatz/Schule) zu etablieren, wo niederschwellige soziale Interaktion und alternative Lernerfahrungen möglich sind. Dabei kann Kunst als Impuls dienen, um gemeinsam über kreative Lösungsstrategien für komplexe Fragestellungen nachzudenken und in einem geschützten Raum Neues zu erproben.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Die Pandemiesituation bietet die Chance zu stärkerer interdisziplinärer Vernetzung innerhalb des Hauses und zur nachhaltigen Einbindung des Kunstvermittlungsteams in kuratorische oder auch Marketing-Tätigkeiten. Umso mehr muss auf gleichwertige Beschäftigungsformen gepocht werden.
Katja Brandes, Studium der Kunstgeschichte / Universität Wien und ECM-Lehrgang / Universität für Angewandte Kunst Wien; Kunstvermittlung Stift Klosterneuburg und Museum Gugging, Literaturvermittlung für Büchereien Wien, seit 2016 Leitung Kunstvermittlung Dom Museum Wien

Mit Anita Thanhofer
Anitas Beitrag ist auf ihrem Blog zu lesen:
Was siehst du?
Anita Thanhofer arbeitet als Kunst und Kulturvermittlerin mit Fokus auf zeitgenössischer Kunst und Kultur im analogen und digitalen Raum. Sie ist tätig in den Bereichen Vermittlung, Lehre, Weiterbildung, Forschung und der Kommunikation im digitalen Raum. Ihre Projekte im Analogen und Digitalen verfolgen interaktive und partizipative Ansätze. Sie ist als Vorstandsmitglied bei den Kulturvereinen arbeitskreisneu Plattform für Kulturvermittlung Salzburg, drum5162 Kulturinitiative zur Verortung von Gegenwartskultur in Obertrum am See und für Super Initiative zur Nutzung von Leerständen als Handlungsraum für Kultur und Wissen, aktiv. Anita Thanhofer studierte Kunstgeschichte an der Universität Salzburg, Universität Wien und Universidad de Sevilla. 2001 diplomierte sie im Fach Kunstgeschichte an der Universität Salzburg. Sie arbeitete als Kunstvermittlerin am Leopoldmuseum Wien (2001) und am Museum der Moderne Salzburg (2004-2012). 2013 gründete sie die Initiative Durchblick mit der sie analoge und digitale Projekte mit Schwerpunkt bildender Kunst und Kommunikation im digitalen Raum initiiert und begleitet. 2019/ 2020 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin des Forschungsprojektes: „Räume kultureller Demokratie. Ein transdisziplinäres Forschungsprojekt zur Entwicklung von experimentellen Vermittlungsräumen am Beispiel von Klimawandel und Nachhaltigkeit“ am Programmbereich Zeitgenössische Kunst und Kulturproduktion, Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst Salzburg. Seit 2020 arbeitet sie als Referentin an der Pausanio Akademie Köln.

Mit Martin Hagmayr
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
Allgemein: interdisziplinär, inklusiv, innovativ
2020: planen, verschieben, absagen
Was ist 2020 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Der Museumsbesuch ist anders als zuvor: Aus „Kommt näher, man darf und soll die Gegenstände in der Ausstellung berühren.“ wurde „Bleibt auseinander und greift bitte nichts an!“
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Meine Top 3:
„Du wartest also den ganzen Tag, darauf das Besucher*innen kommen?“ „Du machst jeden Tag dasselbe, oder?“
„Hast du was zu tun, wenn keine Besucher*innen kommen?“
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Kulturvermittlung ist nicht dafür da, um alles zu erklären. Kulturvermittlung ist meiner Ansicht nach dann gut, wenn Besucher*innen mit mehr Fragen, die für ihr Leben relevant sind gehen, als sie gekommen sind.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Viele Kolleg*innen sind noch immer prekär angestellt, das müssen wir sichtbar machen.
Martin Hagmayr wohnt in Linz und hat in Wien, Berlin und Basel Geschichte studiert. Nach seiner Tätigkeit als Vermittler an mehreren NS-Gedenkstätten ist er seit 2015 im Museum Arbeitswelt Steyr beschäftigt, seit 2018 in leitender Funktion der Abteilung Vermittlung & Wissenschaft. Einer seiner Schwerpunkte ist hier das Feld der Inklusion.

Mit Felix Fröschl
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
Zoom, Nostalgie, Hoffnung
Was ist 2020 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
Die Unmöglichkeit der Planung, der Schub digitaler Arbeitsweisen in seiner Gesamtheit.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Etwas alter Hut, aber gerade jetzt umso deutlicher: Das man als Kulturvermittler nur aktiv vermittelt.
Und: „Ist das nicht fad, wenn man jeden Tag immer dasselbe sagt?“
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Kulturvermittlung macht Wissen greifbar, muss keinem eine Note geben und kann den Gedankenhorizont in ganz neue Richtungen erweitern. Gute Kulturvermittlung hat also das Potenzial einen nachhaltig prägenden Eindruck bei Teilnehmer*innen zu hinterlassen. Das ist eine ungemein wertvolle Eigenschaft.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Kulturvermittlung ist ein Beruf mit Berufsbild und kein Hobby.
Felix Fröschl: Felix Fröschl wohnt in Steyr und ist dort auch aufgewachsen. Studiert hat er Sozialwirtschaft in Linz und ist seit 2016 Kulturvermittler im Museum Arbeitswelt und war zeitweise auch im AK-Di@log in Linz tätig. Eines seiner Haupttätigkeitsfelder im Museum Arbeitswelt ist die Politische Bildung in der hauseigenen Politikwerkstatt DEMOS.

Mit Pia Razenberger
Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
Haltung – Wertschätzung – Bildung
Was ist 2020 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
> Virtuelle Teamsitzungen, die aufzeigen wie wichtig es ist, sich real gegenüber zu sitzen und zu diskutieren.
> Viele digitale Angebote, die leider auch ein klischeehaftes Bild der Vermittlung in den Medien (von Vermittler*innen selbst) reproduzieren.
> Das Aufzeigen der prekären Verhältnisse, in denen sich das Berufsfeld befindet.
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Nicht wenige Personen glaubten, meine Aufgabe wäre es, Kunstwerke an andere Orte oder an Käufer*innen zu „vermitteln“ – im Sinne eines*r Kuriers*in.
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Um an einem als auratisch und allmächtig wahrgenommenen Ort – dem Museum – mit genau dieser Vorstellung zu brechen und die Wahrnehmung des Ortes gleichzeitig zu nutzen, um gesellschaftlich aktuelle Themen mit Menschen, von jung bis alt, zu diskutieren und zu verhandeln. Dadurch kann die geführte Diskussion von den Teilnehmenden als wichtig wahrgenommen werden. Das Potenzial der Vermittlung steckt für mich darin, dass ein Denkanstoß gegeben und etwas ins Rollen gebracht werden kann.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Dass Vermittler*innen eine Haltung gegenüber Bildung, Wissen und Erfahrung in der täglichen Praxis leben und vermitteln, bei der es darum geht, Wertschätzung gegenüber verschiedensten Ansichten, Empfindungen und Meinungen auszudrücken. Um dies zu ermöglichen, überlegen, erarbeiten, erproben Vermittler*innen eigene Methoden und Formate.
Pia Razenberger ist 1990 geboren und studierte Kunstgeschichte in Innsbruck, Granada und Wien. Im Masterstudium spezialisierte sie sich auf Islamische Kunst. 2015 absolvierte sie den Lehrgang für Kulturvermittlung am Institut für Kulturkonzepte. Seit 2016 arbeitet sie als Kulturvermittlerin, ihr Projekt „Tabadul-Austausch“ wurde mit dem Deubner-Projektpreis vom Verband Deutscher Kunsthistoriker ausgezeichnet. Seit 2017 arbeitet sie am Dom Museum Wien, Weltmuseum Wien und Wien Museum. Derzeit ist sie in Karenz.

Foto: Sven Hoppe, CC BY-SA 3.0 commons.wikimedia.org

Welche drei Wörter beschreiben für Dich/Sie Kulturvermittlung heute?
Allgemein: spartenübergreifend, mehrsprachig translatorisch, Teil der formelle Bildung
2020: virtuell, global,; neu-gedacht, transparent, vernetzt
Was ist 2020 – aufgrund der COVID-19 Pandemie – neu?
primär virtuelle Führungen, digitale Formate; DisTanz; Beziehungen-Menschen-Räume-Objekte;
Aufbruch: Kulturvermittlung-Berufsprofil im gesellschaftlich-politischen Kontext (Bildungsauftrag vs. Kurzarbeit, Kündigung, …)
Welches ist das absurdeste Vermittlungs-Klischee, über das Du/Sie gestolpert bist/sind?
Meine Top 3:
„Kinderbetreuung in Museen“; „elitäres Volontariat“; „Wissensprüfer-innen“
Warum brauchen wir die Kulturvermittlung?
Methoden und Formaten der Vermittlungskunst ermöglichen vielfältige Ziugänge zu diversen Themen, Objekten und darin enthaltenen Geschichten, mit diesen Themen und Objekten verbundenen Haltungen und Werten. Die Betrachter*innen können interagieren, aus diverse Perspektiven und Blickwinkeln die Themen und diverse Objekte betrachten und gannzheitlich Wahrnehmen; Kunst-und kulturelle Bildung wird für diverse Zielgruppen erleichtert, bzw. ermöglicht, u.a.
Was möchtest Du/wollen Sie gerne zur Kunst- & Kulturvermittlung noch sichtbar machen?
Berufsprofil- KV, als vielseitiges, vielfältiges Tätigkeitsprofil; spartenübergreifende Vermitltungsprofile und die Zusammenarbeit initiieren, sodass die beruflichen Chancen und Beschäftigungsverträge verbessert werden für die Kulturvermittler*inen, bzw. Bildungsauftrag über die Bildungsministerium in der Zusammenarbeit mit Kunst-und Kulturbetrieben, somit auch die Förderungen für das KV-Personal für die Kunst-und kulturelle Bildung (UNESCO); Eine Initiative wurde hierzu über ACD-Verein gestartet: https://www.acdvienna.org/careers-services/
Tatjana Christelbauer
Kunstschaffende, Kulturvermittlerin
ArtImpact2030
https://www.tatjana-christelbauer.com/kunst-kulturvermittlung/Kulturdiplomatie
LikeLike